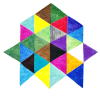die vollversion des artikels mit dem untertitel „gegenübertragung und psychosomatik“ über spezielle übertragungsfelder bei psychosomatischen erkrankungen. „blanche wittmanns busen und ärtzlicher bluthochdruck“ erscheint in der zeitschrift energie & charakter nr.35; CH-bühler; s.67-77.
* artikel: gegenuebertragung und psychosomatik (pdf)